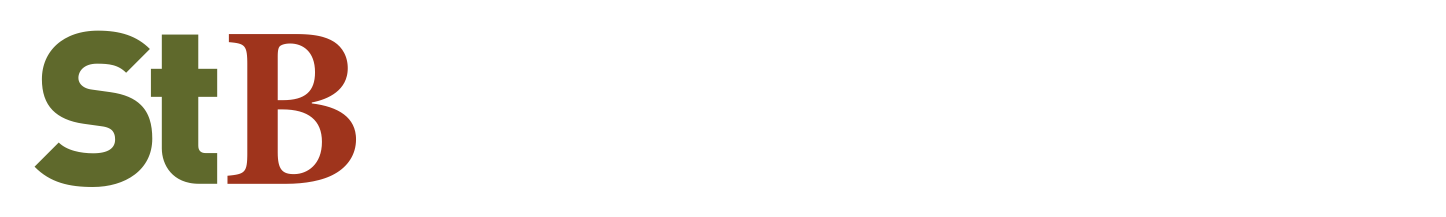Mindestgewinnbesteuerung ist nicht verfassungswidrig!

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts entschied am 23.7.2025 – 2 BvL 19/14, dass die gesetzlichen Regelungen zur Mindestgewinnbesteuerung bei der Körperschaftsteuer, namentlich § 8 Abs. 1 KStG i.V. m. § 10d Abs. 2 EStG und der Gewerbesteuer, § 10a GewStG verfassungsgemäß sind, soweit Körperschaftsteuersubjekte i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1–3 KStG bzw. Gesellschaften i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 GewStG betroffen sind.
Konkret ging es um die Frage, ob die prozentual beschränkte Verlustvortragsregelung mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nach Art. 3 Abs. 1 GG vereinbar ist. Der Sachverhalt der Vorlage durch den BFH ist besonders. Der BFH bezeichnet ihn als “bilanzsteuerrechtlicher Umkehreffekt”. Dahinter steht die Konstellation, dass erhöhte Verlustvorträge aufgrund einer Insolvenz nicht vollständig genutzt werden konnten und so ein “Definitiveffekt” der Besteuerung entstand.
Gesetzliche Regelung: 2004 führte die damalige Regierung die sog. Mindestgewinnbesteuerung ein, indem der Abzug von Verlusten aus Vorjahren betragsmäßig begrenzt wurde. § 8 Abs. 1 KStG i.V. m. § 10d Abs. 2 EStG führte bei der Körperschaftsteuer und § 10a GewStG bei der Gewerbesteuer einen Sockelbetrag von 1 Mio. € ein, bis zu dem Verluste in voller Höhe vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden konnten. Lag der Gesamtbetrag der Einkünfte über 1 Mio. €, so war ein vortragsfähiger Verlust nur bis zu weiteren 60 % des Gesamtbetrags der Einkünfte abziehbar. Gewinn über 1 Mio. € war der Verlustabzug auf 60 %. Der Verlustabzug wurde auf diese Weise zeitlich gestreckt.
Entscheidung des BFH: Der BFH erkannte an, dass die Mindestgewinnbesteuerung in der “Grundkonzeption”, die zeitliche Streckung des Verlustvortrages, nicht gegen Verfassungsrecht verstoße. Allerdings sah er es als problematisch an, wenn auf Grundlage eines Sachzusammenhangs zwischen Verlust und Gewinn die Mindestbesteuerung dazu führen könnte, den Verlustabzug durch die Streckung “gänzlich auszuschließen.”
Entscheidung des BVerfG: Das BVerfG folgte dieser Argumentation nicht. Zunächst muss aus Sicht des BVerfG die Frage beantwortet werden, ob “die Vorschriften der Mindestgewinnbesteuerung in ihrer Grundkonzeption, die auf eine bloße zeitliche Streckung des Verlustvortrags ausgerichtet ist, mit der Verfassung in Einklang stehen.” Das BVerfG erkennt die durch die Vorschrift bedingten “(Un-)Gleichbehandlungen an, misst diese aber am Willkürmaßstab und nicht aber am verfassungsrechtlichen Rechtfertigungsmaßstab einer strengeren Verhältnismäßigkeitsprüfung.
Die Grundkonzeption, d. h. die Beschränkung des Verlustabzugs auf 60 % des GdE wird durch den sachlichen Grund “kontinuierlicher und gegenwartsnaher Besteuerung als besonderem Fiskalzweck” rechtfertigt. Der Staat könne so immer in gewisser Weise auf die Gewinne der Unternehmen zugreifen, ohne dass Altverluste ihm dieses Recht nähmen. Der Gesetzgeber dürfe das Steueraufkommen verstetigen. Die Steuerzahllast werde im Zeitlauf für den Steuerpflichtigen nicht erhöht, sondern die Beitragsbemessungsgrundlage, auf die der Gesetzgeber zugreifen wolle, werde “beständig gemacht”. Es sei zudem nicht ersichtlich, dass der Gesetzgeber durch die Streckung des Verlustvortrags “auf Dauer eine Verstetigung der Staatseinnahmen zu gewährleisten”, evident neben der Sache liege. Der Evaluierungsbericht der Facharbeitsgruppe “Verlustverrechnung und Gruppenbesteuerung” zeige, dass die Vorschriften in den Jahren 2004 bis 2008 gewirkt hätten.
Die Mindestgewinnbesteuerung entspricht, nach Ansicht des BVerfG, den Anforderungen an typisierende Regelungen. Der Gesetzgeber dürfe von der “ewig lebensfähigen” juristischen Person ausgehen. Der Sockelbetrag von 1 Mio. € erfasse zudem nur “große” Unternehmen, was nicht außerhalb des Einschätzungs- und Gestaltungsspielraums des Gesetzgebers liege. Der Prozentsatz und Sockelbetrag seien nicht “evident neben der Sache”. Es ginge um Praktikabilität und Einfachheit der Vorschriften. Auch erscheine nicht von vornherein als ausgeschlossen, dass der Sockelbetrag und die dadurch ermöglichte Nichterfassung von kleinen und mittleren Unternehmen dazu beitragen könne, die Rechtsanwendung zu vereinfachen.
Die Tatsache, dass die zeitliche Streckung des Verlustes zur Nichtabzugsfähigkeit führen kann, verbucht das BVerfG unter der Rubrik “allgemeines Unternehmensrisiko”. Es sei Sache des Unternehmers, für kontinuierliche Gewinne zu sorgen, um so Verluste abzugsfähig zu machen.
Auch in der besonderen Fallkonstellation, dass die nicht ausgeglichenen Verluste aufgrund der Insolvenz des Unternehmens nicht mehr genutzt werden können, vom BFH als sog. “bilanzsteuerrechtlicher Umkehreffekt” bezeichnet, sieht das BVerfG als unproblematisch an. Die mangelnde Verlustnutzung läge nicht an den Vorschriften der Mindestbesteuerung, sondern folge “aus anderen Vorschriften und Rechtsgrundsätzen”. Diese Rechtsfolge habe der Gesetzgeber nicht vorgesehen. Einer Härtefallregelung bedürfe es nicht.
Ein Verstoß gegen die Eigentumsfreiheit, Art. 14 Abs. 1 GG, liege ebenfalls nicht vor.
Conclusio: Das BVerG sieht die Verstetigung des Steueraufkommens als besonders wichtiges Ziel an, welches der Gesetzgeber durch typisierende Regelungen verfolgen darf, ohne gegen das Grundgesetz zu verstoßen. Dahinter scheint die Vorstellung zu stehen, dass das Steueraufkommen ein Kuchen ist, welcher zur Verteilung ansteht. Bemerkenswert ist die Sichtweise, dass die Unternehmen für genügend Gewinne zu sorgen haben, um Verluste der Vergangenheit abzugsfähig zu erhalten. Hier ließe sich auch die Sicht vertreten, dass Gewinne und Verluste bei der steuerlichen Behandlung als zwei Seiten einer Medaille zu behandeln sind und der Staat sowohl die guten wie auch die schlechten Ergebnisse der Unternehmen ertragen muss. Davon macht das BVerfG nun eine Ausnahme und verlagert das Risiko der Verlustnutzung auf die Unternehmen. Eine befremdliche Sicht, fiskalpolitisch motiviert, verständlich, aber auch richtig? Ich meine nein. Die Rosinentheorie sollte keine Anwendung finden.
Prof. Dr. iur. Michael
Stahlschmidt
, M.R.F., LL.M., MBA, LL.M., RA/FAStR/FAInsSanR/FAMedR/StB, Dipl.-Betriebswirt/FH lehrt an der FHDW Paderborn Steuerrecht, Rechnungswesen und Controlling und ist Ressortleiter des Ressorts Steuerrecht des Betriebs-Berater und Chefredakteur Der SteuerBerater, Frankfurt am Main/Medebach.
Stahlschmidt, StB 2025, Heft 09, Umschlagteil, I